
Bilddokumente und Informationen zur Geschichte des Dorfes Kuschkow aus der Spreewaldregion in der Niederlausitz
Startseite Kuschkow-Historie Fotografie und Architektur Impressum und Datenschutz
Urheberrecht
Alle auf dieser Seite verwendeten Fotos und Abbildungen sind
urheberrechtlich und nutzungsrechtlich geschützt.
Bildquellen und Rechteinhaber sind jeweils in den Bildunterschriften oder im
Fließtext angegeben, siehe Impressum.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Kuschkow am nördlichen Rand der Niederlausitz
Dies ist die private Website von Doris Rauscher,
aufgewachsen als Doris Jäzosch in Kuschkow, die ältere Tochter des Müllermeisters Manfred Jäzosch
und seiner Ehefrau Jutta Jäzosch, geborene Thiele. Großvater war der Kuschkower Schmied und spätere
Müllermeister Bernhard Jäzosch. Ziel der Website ist es, möglichst viele der noch existierenden
Dokumente, Fotos und Berichte mit ortsgeschichtlichem Bezug zu Kuschkow der Öffentlichkeit
vorzustellen. Die Website versteht sich als persönliche Familien- und Heimatseite und gleichzeitig
als sachliches Informationsangebot und digitales Archiv zur Dorfgeschichte. Die Bearbeitung der
Website mit allen Unterseiten erfolgt gemeinsam durch Doris und Norbert Rauscher.
Oben sehen Sie drei kleine Bildausschnitte aus historischen topographischen Karten. Die
vollständigen Kartenblätter und Bildquellen finden Sie unten im Text. Die Inhalte dieser
Website werden nach bestem Wissen regelmäßig aktualisiert und erweitert, je nach zur Verfügung
stehenden Dokumenten und Erkenntnissen. Anregungen, Korrekturen und sonstige Hinweise werden
gern entgegengenommen und eingearbeitet, Kontaktdaten siehe ganz unten.
Hinweis: Diese Website und ihre Unterseiten sind optimiert für Desktop-PC
und Notebook bzw. Laptop, nicht jedoch für Tablet und Smartphone, dort kommt es leider zu Fehldarstellungen.
Seitenübersicht
► Startseite Kuschkow-Historie ‒ Das Dorf Kuschkow und seine Geschichte in Bildern und Texten
► Die Kuschkower Mühle ‒ Mühlengeschichte und die Müllerfamilien Wolff / Jäzosch
► Die Schmiede der Familie Jäzosch ‒ Geschichte einer Dorfschmiede mit ihren Familien ab 1435
► Jutta Jäzosch, geborene Thiele ‒ Familiengeschichte Thiele mit Flucht und Vertreibung
► Hochzeitsfeiern und Hochzeitsfotos ‒ Teil 1 ‒ Das Heiraten in Kuschkow und der Niederlausitz
► Hochzeitsfeiern und Hochzeitsfotos ‒ Teil 2 ‒ Das Heiraten in Kuschkow und der Niederlausitz
► Die Dorfschule in Kuschkow ‒ Dorflehrer und Schulkinder in Bildern und Texten
► Schulchronik der Gemeinde Kuschkow ‒ Teil 1.1 ‒ 1891 bis 1924 ‒ Seiten 0 bis 77
► Schulchronik der Gemeinde Kuschkow ‒ Teil 1.2 ‒ 1924 bis 1929 ‒ Seiten 78 bis 111
► Schulchronik der Gemeinde Kuschkow ‒ Teil 1.3 ‒ 1929 bis 1947 ‒ Seiten 112 bis 148, Beilagen
► Schulchronik der Gemeinde Kuschkow ‒ Teile 2 und 3 ‒ 1947 bis 1953
► Schulchronik der Gemeinde Kuschkow ‒ Teil 4 ‒ 1953 / 1960 bis 1968 ‒ Meine eigene Schulzeit
► Klassenbücher aus der Dorfschule in Kuschkow ‒ Jahrgänge 1950/1951 und 1954/1955
► Klassenbuch aus der Dorfschule in Kuschkow ‒ Jahrgang 1958/1959
► Die Lehrerin Luise Michelchen ‒ Ein 107-jähriges Leben in Berlin-Charlottenburg und Kuschkow
► Die Kuschkower Feuerwehr ‒ Dorfbrände, Feuerwehrgeschichte und Feuerwehrleute
► Historische topographische Karten ‒ Kuschkow und die Niederlausitz auf Landkarten ab 1687
► Separationskarten und Flurnamen ‒ Vermessung und Flurneuordnung in der Gemarkung ab 1842
► Der Friedhof in Kuschkow ‒ Friedhofsgeschichte, Grabstätten und Grabsteine
► Verschiedenes ‒ Teil 1.1 ‒ Bilddokumente aus Kuschkow und Umgebung ‒ Zeit vor 1945
► Verschiedenes ‒ Teil 1.2 ‒ Bilddokumente aus Kuschkow und Umgebung ‒ Zeit um 1940 bis 1960
► Verschiedenes ‒ Teil 2.1 ‒ Bilddokumente aus Kuschkow und Umgebung ‒ Zeit um 1950 bis 1965
► Verschiedenes ‒ Teil 2.2 ‒ Bilddokumente aus Kuschkow und Umgebung ‒ Zeit nach 1960
► Reiten und Reiter in Kuschkow ‒ Reitfeste, Reiterspiele und Brauchtum mit Pferden
► Historische Ortsansichten ‒ Teil 1 ‒ Fotos und Zeichnungen aus anderen Orten der Niederlausitz
►
Historische Ortsansichten ‒ Teil 2
‒ Fotos und Zeichnungen aus anderen Orten der Niederlausitz
Das Dorf Kuschkow und die Niederlausitz
auf alten Karten
Kuschkow gehörte nach den Vermutungen der Historiker zur Burggrafschaft Lübben, später zur Landvogtei,
ab 1666 als Amtsdorf zum Amt Lübben und mit Beginn der preußischen Herrschaft ab 1815 bis 1874 zum Rentamt
Lübben. Da die Spree mit ihrem Bogen im Norden und im Westen die äußere Grenze der zum Amt Lübben gehörenden
Dörfer bildete, nannte man das Gebiet innerhalb des Bogens vom 16. Jahrhundert an Krum(m)spreekreis (alte
Schreibweise unter anderem auch: Der Crumspreeische Creis). Auf mehreren der unten gezeigten Karten taucht
diese Bezeichnung in unterschiedlicher Schreibweise auf, der "Krumspreeische Kreiß" wird teilweise
gleichgesetzt mit dem "Lübbenischen Kreiß", so z.B. auf der vierteiligen Karte von
Peter Schenk 1757.
Mit Übergang des Gebietes von Sachsen an Preußen wurden Lübben weitere Dörfer außerhalb des Spreebogens
zugeordnet, was diese Bezeichnung hinfällig machte. Die Stadtbücher von Lübben, erhalten ab 1384 (ältere
sind leider zerstört), geben wichtige Informationen über die Bürger Lübbens und die an Lübben
abgabepflichtigen Dörfer. Im Urkundenbuch der Stadt Lübben, II. Band: Die Lübbener Stadtrechnungen des
15. und 16. Jahrhunderts, herausgegeben von Woldemar Lippert, werden Einnahmen aus dem Dorf Kuschkow
(Cuskow) ab 1423 aufgeführt. Folglich müssen und können in Überlegungen zu Kuschkow
die historischen Erkenntnisse um Lübben Beachtung finden; dies gilt auch für die kartographischen
Darstellungen.
Wie die folgenden Kartenausschnitte sowie die Angaben im Literaturverzeichnis belegen, gab es viele
unterschiedliche Varianten für den Namen Kuschkow, eine Ortsbezeichnung mit vermutlich slawischem
Ursprung. In älteren Publikationen vor 1900 sowie in amtlichen Dokumenten erscheint das Dorf
gelegentlich auch in der eingedeutschten Schreibweise als Kuschkau.
Die folgende Karte von ca. 1687 ist die älteste bekannte kartographische Darstellung,
auf der das kleine Ambtsdorff Kuschko in der Region Unterspreewald verzeichnet
ist. Danach folgen in chronologischer Reihenfolge weitere Karten:


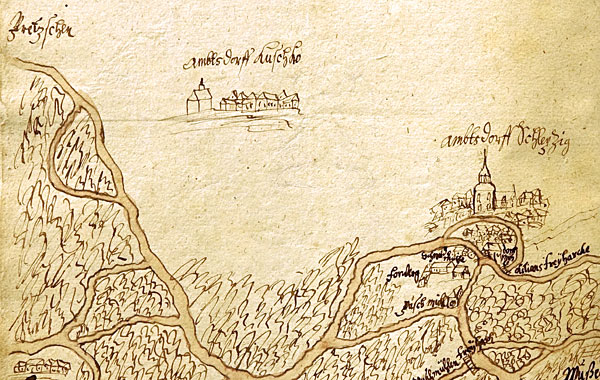
Karte betreffend den Unterspreewald von Lübben bis Leipsch / Pretschen
(ca. 1687). Bildquelle: Foto der historischen Originalkarte, Fotografin: Doris Rauscher,
© Brandenburgisches Landeshauptarchiv (BLHA), Signatur: 17B 5015,
enthalten in der Akte "Die Untersuchung der Amtsgrenze des Amtes Neu Zauche von 1687/88 und 1713",
darin Blatt 8-9 mit der Karte von ca. 1687. Oben zu sehen ist die Gesamtansicht der Karte, darunter links
das Titelblatt der Akte, rechts daneben ein Kartenausschnitt mit Pretschen (Pretzschen)
sowie den Amtsdörfern Kuschkow (Kuschko) und Schlepzig. Wenn Sie Vergrößerungen sehen
wollen von der Gesamtkarte und dem Titelblatt der Akte, dann klicken Sie auf diese Abbildungen. Die
Bezeichnung der Akte lautet im Original: "Acta V. 711. Die Untersuchung der Neuzauchschen
Ambtsgräntzen, bes. a d. 1687 1688 et 1773. ..."
Es handelt sich um die älteste Karte mit dem Amtsdorf Kuschkow (Ambtsdorff Kuschko),
gezeichnet (skizziert) und koloriert mit brauner Tinte. Die Karte ist nicht wie heute üblich genordet
sondern "gesüdostet", Süd-Osten ist in der Darstellung somit oben. In Kuschkow ist die kleine
alte Kirche bzw. Kapelle eingezeichnet, die sich zu der Zeit mit dem Friedhof abseits vom damaligen
Dorf in Richtung Pretschen befand (Bereich "Lücke" nördlich der Pretschener Straße). Die
eingezeichneten Häuser befanden sich an der Dorfstraße. Zu finden sind auch die Amtsdörfer Schlepzig,
Hartmanndorf, Steinkirchen (mit Glockenturm) sowie die Stadt Lübben mit Schloss, Kirche mit dem neuen
Kirchturm (1681, Paul Gerhard war bereits 1676 gestorben), Mühle (1677), dem Frauenberg mit Kloster,
alles 1623-1815 zur Niederlausitz im Besitz der Wettiner gehörend, zum Zeitpunkt der Kartenerstellung
1687 unter Herzog Christian I. von Sachsen-Merseburg. Man findet auch die Bezeichnungen der Flussläufe,
Wälder und Pusche (Wäldchen, Busch, Gehölzgruppe) wie den Streitpusch. Die brandenburgischen Dörfer
Wasserburg, Krausnick und Leibsch sind als solche ausgewiesen. Leider ist die Grenze zwischen
Sachsen und Brandenburg nicht eingezeichnet.
.jpg)
.jpg)
Das gesamte Markgraftum der Lausitz mit Graf- und Herrschaften ... (1716-1724).
Undatiertes Kartenblatt von Johann Hübner und Johann Baptist Homann mit lateinischer Beschriftung,
oben die Gesamtansicht der Karte, unten ein Ausschnitt aus der Niederlausitz mit der
Ortsbezeichnung Kusch für Kuschkow. Bildquelle: ©
Museum Schloss Lübben, Museumsarchiv, mit freundlicher Genehmigung fotografiert von Doris Rauscher
am 18.11.2024. Die Vergrößerung des Gesamtblattes sehen Sie hier:
►. Ein
anderes Exemplar dieser Karte findet man z.B. bei Wikipedia (siehe direkt hier:
►),
gemeinfrei, Dateibezeichnung: Lausitz_map_18thC.jpg, Bildtitel: Karte der Nieder- und Oberlausitz
zwischen 1715 und 1724 von Johann Hübner & Johann Baptist Homann, Nürnberg (ohne Jahresangabe).
Mit den Pünktchen-Linien sind keine Straßen dargestellt sondern die Grenzen der Herrschaften.
Die Niederlausitz war ein Herrschaftsgebiet mit teilweise sehr unterschiedlichen
Landschaftsräumen. Informationen zu Entstehung, naturräumlicher Abgrenzung und Beschreibung der
Region Unterspreewald (Niederspreewald) als Teilgebiet innerhalb der Niederlausitz,
zu dem auch die Gemarkung Kuschkow gehört, findet man z.B. bei Wierd Mathijs de Boer: Entstehung
und Geomorphologie des Unterspreewaldes (siehe unten im Literaturverzeichnis, oder direkt hier:
►).
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Geographische Delineation des Marggrafthums Nieder-Laussitz. ... nach Zürnerischer
Methode eingehohlet und mappiret von A. F. Zürner. Königl. Pohln. und Churf. Sächs. Land und Grentz
Commissario wie auch Geographo. Kolorierte Federzeichnung von Adam Friedrich Zürner
(1679-1742, Sachsen), enthalten in: Atlas Augusteus Saxonicus (Exemplar A): Ämterkarte von der
Niederlausitz in vier Teilen, 1711-1742. Digitalisiert von der Deutschen Fotothek /
Sächsische Landes- und Universitätsbibliothek Dresden unter
https://www.deutschefotothek.de/documents/obj/90011286/dd_hstad-mf_0000651 (siehe direkt hier:
►)
Hier auf der Webseite wird nur der erste Teil (oben links) der vierteiligen Gesamtkarte gezeigt mit
der Ortslage Kuschkow, im Kartenbild bezeichnet als Kuschcka, in der Ortsliste
unterhalb des Kartenbildes (Teil 3) als Kuschcke. Zuerst das gesamte Kartenblatt Teil 1,
danach ein Bildausschnitt aus diesem Blatt mit dem Krumspreeischen Creis, zuletzt ein
Ausschnitt mit dem näheren Umfeld des Dorfes Kuschkow. Auf der Website der Deutschen Fotothek kann man
alle vier Teile incl. Ortsregister in hoher Auflösung betrachten, siehe
direkt hier:
1►
2►
3►
4►
Die Dörfer sind auf dieser und den folgenden beiden Karten mit einer
ganz speziellen Symbolik dargestellt, mit der die individuelle
Ausstattung des jeweiligen Ortes angezeigt wird. Leider enthalten die
Karten keine Planzeichenerklärung, sodass die Bedeutung der Symbole hier
nur vermutet werden kann. Als Orientierung soll das unten ausführlich
vorgestellte Kartenwerk von Peter Schenk aus dem Jahr 1757 dienen,
welches eine Planzeichenerklärung mit vergleichbaren Symbolen enthält.
Jeder Kartograph hat im Detail jedoch seine eigenen Symbole verwendet,
Kartenvergleiche sind mit Vorsicht zu behandeln, eine einheitliche
Systematik existierte nicht.
.jpg)
.jpg)
Hier noch eine weitere Karte von A. F. Zürner: Accurate geographische Delineation des Margrafthums
Nieder Laussitz nach Zürnerischer Methode Geographice eingehohlet und mappiret. (Vorarbeiten zu
einer Karte von Adam Friedrich Zürner, vor 1742). Zuerst wieder das
gesamte Kartenbild, danach ein Ausschnitt mit Kuschkow und Umgebung. Auch diese Karte wurde digitalisiert
von der Deutschen Fotothek / Sächsische Landes- und Universitätsbibliothek Dresden unter
https://www.deutschefotothek.de/documents/obj/90013019/dd_hstad-mf_0017853 (siehe direkt hier:
►)
Die Ortslage Kuschkow ist hier im Kartenbild bezeichnet als Kuschkau (die eingedeutschte
Variante von Kuschkow). Daneben sind zwei sehr interessante Details zu sehen: Die Wegeverbindungen
zwischen den Dörfern Kuschkow und Gröditsch sowie zwischen Dürrenhofe und Krugau über das große Luch
(Feuchtgebiet) hinweg waren offenbar als Knüppeldämme ausgebaut, jedenfalls lässt sich die graphische
Darstellung so deuten. Auf der Website der Deutschen Fotothek kann man auch dieses Kartenblatt vollständig
und in hoher Auflösung betrachten.
.jpg)
.jpg)
Das Marggrafthum Nieder-Lausitz verfertigt von J. G.
Schreibern in Leipzig (1748). Bildquelle für das Kartenblatt:
© Museum Schloss Lübben, Museumsarchiv, mit
freundlicher Genehmigung abfotografiert von Doris Rauscher am 18.11.2024. Kuschkow
ist im Bildausschnitt zu sehen unter der Ortsbezeichnung Kusche.
Kirchensymbole sind eingetragen bei Krugau (Kruge), Dürrenhofe (Dürrenhoff)
und Groß Leuthen (Leüthel). Die Gesamtkarte in größerer Ansicht sehen
Sie hier:
►. Die Karte stammt aus dem Buch "Geographische
Beschreibung der Marggrafschaft Nieder-Lausitz und der angäntzenden Oerter in
Schlesien. Anno 1748." Ein Autor des Buches ist nicht angegeben, die
Autorenschaft ergibt sich aus den Kartenbeschriftungen. Autor war der
Kupferstecher Johann George Schreiber (1676-1750) aus Leipzig. Das Buch
ist digitalisiert zu finden bei der Universitäts- und Landesbibliothek
Sachsen-Anhalt in Halle unter https://opendata.uni-halle.de
Diese Karte findet man in besserer Qualität bei: ©
David Rumsey Map Collection, Cartography Associates, Stanford University Libraries (www.davidrumsey.com),
einen Blattausschnitt mit der gesamten Karte verkleinert sehen Sie hier:
►.
Das gesamte Blatt in sehr hoher Auflösung und hervorragender Qualität
zum freien Download (mit Nutzungsbedingungen) gibt es bei David Rumsey,
dort in der Suchleiste unter > Search the collection > by Maps >
das Suchwort "Niederlausitz" eingeben.
_(DSC00359-11).jpg)
_(DSC00359-12).jpg)
Karte der nördlichen Niederlausitz um 1758, darin enthalten der "Krummspreeische Kreis" /
Circulus Crumspeicensis. Bildquelle: Foto der historischen Originalkarte, ©
Brandenburgisches Landeshauptarchiv (BLHA), Signatur: AKS 1456 C; Fotografin: Doris Rauscher; oben die Gesamtansicht
der Karte, unten ein Ausschnitt mit der Ortsbezeichnung "Kuschke" (so auch bei Zwahr 1847,
Niederlausitz-wendisch-deutsches Handwörterbuch, Seite 178; siehe Literaturverzeichnis ganz unten). Es handelt sich
um eine unvollendete und damit unvollständige Ausführung (Fragment) der Karte, angelehnt an die Karte von Peter
Schenk, Amsterdam. Neben dem Krummspreeischen Kreis sind auch Teile des Beeskow-Storkowschen Kreises zu sehen.
Außerdem gehört sie zu den ersten Karten, auf denen auch das überörtliche / regionale sowie teilweise das
überregionale Straßensystem dargestellt wurde; siehe dazu die Angaben weiter unten zu Peter Schenk und
Johann Baptist Homann. Bei den Pünktchenlinien handelt es sich auf dieser Karte offenbar nicht um Straßen
oder Wege sondern um die Abgrenzungen der Herrschaftsgebiete bzw. Amtsgebiete.
.jpg)
Ausschnitt aus einer anonymen Karte der brandenburgischen Mittelmark von
1807, bezeichnet mit "Carte Spécielle de la Moyenne Marche corrigée et
publiée l'année 1807" (Spezialkarte der Mittelmark, korrigiert und veröffentlicht im
Jahr 1807), mit den Ortsbezeichnungen Kusskow (Kuschkow), Kregisch
(Gröditsch), Düsterhof (Dürrenhofe), usw. Bildquelle: ©
David Rumsey Map Collection, Cartography Associates, Stanford University Libraries (www.davidrumsey.com).
Bei der Karte handelt es sich um eine Faltkarte (vermutlich eine Reisekarte), die in Blattsegmente
geschnitten und auf Leinengewebe aufkaschiert wurde, leider durch Stockflecken beschädigt.
Einen größeren Kartenausschnitt sehen Sie hier:
►,
das gesamte Blatt verkleinert hier:
►.
Das gesamte Blatt in sehr hoher Auflösung und hervorragender Qualität
zum freien Download (mit Nutzungsbedingungen) gibt es bei David Rumsey,
dort in der Suchleiste den französischen Kartentitel eingeben.
Die Karte ist zur Zeit der französischen Besatzung entstanden (Napoleonische
Kriege, 1806-1813), daher wohl der französische Kartentitel. Die Planzeichenerklärung
ist jedoch deutsch, demnach wurde die Karte gezeichnet durch deutsche Kartographen
und vermutlich hergestellt und publiziert durch einen deutschen / preußischen Verleger.
Kuschkow ist nach der Symbolik gemäß Planzeichenerklärung (auf der Gesamtkarte unten
links) lediglich als Dorf eingetragen, aber nicht als Pfarrdorf oder Kirchdorf, was
darauf hindeutet, dass zu dieser Zeit keine Kirche existierte. Die alte Fachwerkkirche
war vermutlich schon abgebrochen oder bei dem großen Dorfbrand von 1790
mit abgebrannt. Die Dörfer Krugau und Groß Leuthen sind dagegen
jeweils mit dem Symbol für ein Pfarrdorf bezeichnet, Kuschkow gehörte zu Krugau.
Durch das Luch zwischen Kuschkow und Gröditsch gab es keine Wegeverbindung, siehe
dazu auch die Karten oben und die folgende Karte; nur 1742 wurde eine Verbindung als
Knüppeldamm dargestellt. Die Chaussee (Chaussé) Luckau ‒ Lübben ‒ Beeskow
ist eingetragen, alle anderen Ortsverbindungen wurden als "gemeine Wege"
markiert. Mit farbigen Rahmungen und den römischen Ziffern I bis X sind die zehn
Kreise der brandenburgischen Mittelmark abgegrenzt. Die Niederlausitz war zu
dieser Zeit noch sächsisch.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Karte des Lübbener Kreises, Regierungs-Bezirk
Frankfurt, von F. A. Witzleben, Hauptmann im Generalstab. Berlin
1836. Maßstab 1:200000 (Meilen), gezeichnet von
Nowack, lithographiert von B. Delius. Oben die Gesamtansicht
(Vergrößerung siehe hier:
►),
darunter ein Ausschnitt mit der Umgebung von Kuschkow und der
Ortsbezeichnung Kuschko (Vergrößerung siehe hier:
►),
links die Planzeichen-Erklärung. Bildquelle: ©
Museum Schloss Lübben, Museumsarchiv, mit freundlicher Genehmigung fotografiert
von Doris Rauscher am 18.11.2024. Das Museum verfügt über eine umfangreiche
Foto- und Kartensammlung, ein Besuch ist sehr zu empfehlen.
Die Karte ist außerordentlich interessant, weil sie mit
militärisch-kartographischer Genauigkeit auch die Straßen
zwischen den Ortschaften zeigt. Zu der Zeit, als die Niederlausitz
bereits zu Preußen gehörte, gab es Straßenverbindungen über die Spree
von Kuschkow aus in die nördlich angrenzenden altpreußischen Gebiete
nur über Pretschen und Kossenblatt (Cossenblatt). Wer mit dem Fuhrwerk
von Kuschkow nach Berlin wollte, musste die Landstraßen über Pretschen
‒ Kossenblatt ‒ Beeskow ‒ Storkow ‒ Königs
Wusterhausen nehmen. Die Spreebrücke vor Kossenblatt war bis 1815
gleichzeitig die Grenz- und Zollbrücke zwischen Sachsen und Preußen.
Eine Straße zwischen Kuschkow und Neu Lübbenau existierte noch nicht.
Windmühlen sind in der Umgebung von Kuschkow nur bei den Dörfern
Pretschen, Wittmannsdorf, Bückchen und Groß Leuthen eingetragen. Die
Kuschkower Mühle wurde erst 1846 errichtet, siehe dazu die folgende
Karte sowie die Mühlenseite.
.jpg)
.jpg)
Preußische Kartenaufnahme 1 : 25 000 - Uraufnahme 1846, aufgenommen und
gezeichnet von Winterfeld; Blattausschnitte mit der Ortslage Kuschkow. Bildquelle: Herausgegeben
von der Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg 2007 (Blatt-Nr.: 3949 Schlepzig,
1846), das Original befindet sich im Besitz der Staatsbibliothek zu Berlin ‒ Preußischer
Kulturbesitz. Die erste Karte, auf der das Dorf nicht nur symbolhaft dargestellt wurde sondern
in seiner städtebaulichen / dorfbaulichen Struktur mit Straßen, Bebauung, Gärten, Grünland,
Acker, Wald und Gewässern erkennbar ist. Auch die Mühle südöstlich außerhalb des Dorfes
ist eingetragen. Auf dem größeren Bildausschnitt oben sieht man, dass 1846 noch immer keine
Straßenverbindung von Kuschkow über Neu Lübbenau ("Colonie Neu Lübbenau") bis
Leibsch existierte, Leibsch war 1846 noch ein Sackgassendorf. Am Ort der 1879 erbauten
Brücke über die Spree existierte damals nur eine Furt (auf der Karte bezeichnet mit
"Fuhrt"), die nur bei Niedrigwasser genutzt werden konnte. Hier sehen Sie
eine Vergrößerung dieses Blattausschnitts:
►.
_(DSC09940-11).jpg)
_(DSC09940-12).jpg)
_(DSC09932-11).jpg)
Karte der Feldmark Kuschkow 1842 / 1857. Bildquelle: Fotos der historischen
Originalkarte, © Brandenburgisches Landeshauptarchiv (BLHA), Signatur:
Rep. 24 Lübben K 42 G/ÜF; Fotografin: Doris Rauscher; zwei Ausschnitte aus der riesigen Gesamtkarte
sowie das Schriftfeld mit dem Text: "Rein Karte von der Feldmark Kuschkow.
Zur Krugauer Kirche gehörig. Regierungsbezirk Frankfurt, Kreises Lübben. Vermessen im Jahre
1842 durch Klein II, copirt im Jahre 1857 von L. Koch IV, Reg. Geometer."
Es handelt sich um die zweite sogenannte "Separations-Reinkarte" von Kuschkow,
Ursprung für die heutigen Liegenschaftskarten / Flurkarten, ein seltenes und äußerst
wertvolles Dokument. Die Kuschkower Mühle ist auf dieser Karte nicht eingetragen, nach
der Karte von 1846 (siehe oben) existierte sie aber. Die Karte ist nicht genordet, zum
Vergleich siehe das korrekt genordete nachfolgende Messtischblatt. Das Schriftfeld war
bei den gegebenen Verhältnissen im Landeshauptarchiv leider nicht anders fotografierbar.
Die erste Ausfertigung dieser Separationskarte / Reinkarte, hier aus dem Bestand des Kataster-
und Vermessungsamtes Lübben, verbunden mit einer Liste der historischen Flurnamen
in der Gemarkung Kuschkow, sehen Sie auf einer besonderen Seite, dazu gibt es ausführliche
Erläuterungen zu den Themen Separation und Anfertigung der Separationskarten in der Provinz
Brandenburg und speziell in der Niederlausitz sowie ein Literaturverzeichnis nur zu diesem Thema:
►
Separationskarten und Flurnamen des Dorfes Kuschkow
Siedlungsstruktur: Die detailreich
gezeichnete Separationskarte zeigt sehr gut die städtebauliche / dorfbauliche Struktur
von Kuschkow. Demnach handelt es sich bei dem historischen Kernbereich des Dorfes um
ein Straßendorf mit stark erweitertem Straßenraum, schon im Übergangsbereich zum
Angerdorf, besonders das südliche Ende der Dorfstraße ist angerartig erweitert. Ein
planmäßig angelegter Dorfgrundriss ist erkennbar. Ob diese 1842 dokumentierte
planmäßige Parzellierung dem mittelalterlichen Dorf aus der Gründungszeit entspricht
oder ob die breite Dorfstraße erst bei einem späteren Wiederaufbau des Dorfes nach
Zerstörung angelegt wurde, um etwa aus Brandschutzgründen die Hofabstände zu
vergrößern oder um eine angerartige Freifläche für die Dorfgemeinschaft zwischen den
privaten Höfen zu erhalten, muss offen bleiben, dazu gibt es bisher keine Erkenntnisse.
Siehe dazu auch die Anmerkungen von Alfred Rattei von 1963 (wiedergegeben ganz am
Ende der Schulchronik).
Dennoch ist Kuschkow kein Angerdorf. Es fehlt die allseitig von der Dorfstraße umschlossene
zentrale Angerfläche, auf der sich ursprünglich in den meisten Angerdörfern mindestens
die Kirche mit Friedhof sowie je nach Platzverhältnissen auch Schmiede, Hirten-
und Küsterhaus, Schule und Spritzenhaus sowie ein Dorfteich als Viehtränke und
Feuerlöschteich befanden. Eine in dieser Form als "Allmende" nutzbare Fläche
gab es nie in Kuschkow zwischen den beiden Hofreihen an der Dorfstraße, die Straße war
offenbar schon immer die zentrale Erschließungsachse für alle anliegenden Bauern- und
Kossätenhöfe und die Dorfkirche befand sich schon immer nördlich außerhalb des Dorfes.
Die heutige Bezeichnung der Dorfstraße als "Dorfanger" ist daher zumindest
aus siedlungsgeschichtlicher Sicht nicht ganz zutreffend. Erst später haben sich entlang
der Ausfallstraßen in Richtung Gröditsch, Pretschen und Neu Lübbenau kleinere Hofstellen
entwickelt. Die alten Höfe der Bauern befanden sich an der Dorfstraße, hier liegt der
Ursprung von Kuschkow, bis heute ist dies im Dorfgrundriss ablesbar. Weitere Angaben
zur allgemeinen Entwicklung der brandenburgischen Dorfformen siehe hier:
►
Interessante Informationen zum Vergleich bietet auch der Ausgrabungsbericht zum Dorf Horno
von 2004 vor seiner Zerstörung durch Abbaggerung für den Braunkohletagebau: Henker / Kirsch,
Dorfgründungen in der Lausitz, dort Seite 179 mit einer Zeichnung der Dorfanlage (siehe unten,
Literaturverzeichnis, oder direkt hier:
►).
Das mittelalterliche Dorf Horno hatte eine mit Kuschkow vergleichbare Struktur, ein Straßendorf mit
einer sehr breiten Dorfstraße, hier jedoch mit einer einseitigen Erweiterung zum echten Anger mit
Kirche und Friedhof sowie Dorfteich am Ende der Straße, es wird deshalb zu Recht als Straßenangerdorf
bezeichnet, eine Mischform aus Straßendorf und Angerdorf. Auch die auf Basis der Grabungsbefunde
vermutete Hofstruktur sowie die Giebelstellung der Bauernhäuser dürften mit dem mittelalterlichen
Kuschkow vergleichbar sein.
.jpg)
Topographische Karte, Blatt 110 Luckau, Einzelblatt aus
einem unbekannten Kartenwerk um 1867 (das gesamte Blatt
sehen Sie hier:
►), unten rechts ist eine Maßstabsleiste für "1 geographische
Meile zu 1969,85 Preußische oder Rheinländische Ruthen" angegeben, jedoch
ohne Verhältniszahl zum Blattmaß der Karte, gezeichnet von II. v. Pogda (Poyda ?),
gestochen von Wilhelm Voss (Vose ?), der Name des Kartenwerks oder ein Verlag
sind nicht angegeben. Bildquelle: © Museum
Schloss Lübben, Museumsarchiv, Inventar-Nummer: V/985, mit freundlicher
Genehmigung abfotografiert von Doris Rauscher am 18.11.2024.
Das Kartenblatt zeigt die Verkehrsverhältnisse in der nördlichen
Niederlausitz im weiteren Umfeld von Kuschkow, es gehört zu den ersten Karten
mit dem neuen Eisenbahnnetz. Die Bahnlinie Berlin ‒ Lübben ‒ Cottbus
‒ Görlitz wurde 1866 in Betrieb genommen als "Görlitzer Bahn"
mit dem "Görlitzer Bahnhof" in Berlin als Startbahnhof; heute befindet
sich an dieser Stelle in Berlin-Kreuzberg der "Görlitzer Park". Als
Entstehungszeit für die Karte bleibt somit der Zeitraum zwischen 1866 und
1869 (Einführung des metrischen Maßsystems in Preußen und damit Ablösung
der Meile durch den Kilometer). Die in Lübbenau abzweigende Strecke über
Calau (Kalau) und Senftenberg in Richtung Kamenz wurde erst 1874 in Betrieb
genommen, sie ist auf der Karte mit der Signatur "geplant"
dargestellt. Kuschkow hat weiterhin keine direkte Straßenverbindung zu
den nördlich angrenzenden Gebieten. Die nächstgelegene überörtliche
Chaussee und Poststraße verläuft zwischen Lübben und Beeskow (heute
Bundesstraße B 87).
Diese Chaussee zwischen Leipzig ‒ Lübben ‒
Beeskow ‒ Frankfurt (Oder) wurde ab 1854 angelegt,
überwiegend durch Ausbau einer bereits vorhandenen sehr alten Handels- und
Poststraße; weitere Angaben dazu siehe ganz unten zur "Reisekarte
für das Kurfürstentum Sachsen nach Johann Baptist Homann 1728 / 1752".
Organisation und Finanzierung der Chausseebauten im 19. Jahrhundert
lagen in Preußen meist in den Händen privater Chausseebau-Gesellschaften,
so auch in diesem Fall. Die Finanzierung erfolgte durch Ausgabe von Aktien
sowie staatliche und kommunale Zuschüsse bzw. Beteiligungen. Fast alle dieser
Gesellschaften wurden später vom Staat übernommen bzw. die fertiggestellten
Chausseen vom Staat oder den Landkreisen / Kommunen gekauft.
Im Familienarchiv Jäzosch hat sich die folgende Aktie angefunden, ausgestellt
auf den Erbrichtergutsbesitzer Johann Christian Müller
aus Kuschkow, leider nur als Schwarz-Weiß-Foto des stark beschädigten
Originals, das Original existiert nicht mehr. Johann Christian Müller
war der Vater von Mathilde Charlotte Müller, die 1861 den Kuschkower
Mühlmeister Theodor Albert Gustav Adolf Wolff geheiratet hat. Aus
dieser Ehe ging der spätere Müllermeister Franz Hermann Wolff
(1867-1936) in Kuschkow hervor, mein Urgroßvater. Weitere Angaben
dazu gibt es auf der Mühlenseite.
.jpg) Actie
der Frankfurt a. d. O. - Leipziger Chaussee - Gesellschaft. No. 899.
Funfzig Thaler Courant.
Actie
der Frankfurt a. d. O. - Leipziger Chaussee - Gesellschaft. No. 899.
Funfzig Thaler Courant.
Der Erbrichtergutsbesitzer (?) Johann Christian Müller zu Kuschkau hat zur Gesellschafts-Kasse = Funfzig Thaler Preuss. Courant =
eingezahlt, und nimmt auf Höhe dieses Betrages in Gemäßheit des von Sr.
Majestät dem Könige von Preußen bestätigten Statuts vom 19ten April /
20sten November 1854 verhältnismäßig Antheil an dem gesammten Eigenthum,
Gewinne und Verluste der Gesellschaft.
Lübben, den 20. Januar 1857
Directorium der Frankfurt a. d. O. - Leipziger Chaussée-Gesellschaft.
(Oben links handschriftlich "Duplicat", sowie darunter ein Rundstempel:
"Ein Sechstel Thaler 5 Gr." Eine gut lesbare Vergrößerung des
Bildes sehen Sie hier:
►)
_1.jpg) Zum
optischen Vergleich wird links eine Aktie derselben Serie gezeigt, die
auf der Auktions-Website "F.H.W. Freunde Historischer Wertpapiere"
(www.fhw-online.de) angeboten wurde; eine interessante Adresse für
Sammler und Liebhaber historischer Aktien und Wertpapiere. Dort heißt es
im Begleittext:
"... Von der zu überbrückenden Entfernung her war dies
das größte private Straßenbauprojekt aller Zeiten in Deutschland. ...
Die 1854 begonnene Kunststraße von Frankfurt a.d.O. nach Leipzig wurde
1856 bis Müllrose gebaut. Nach der Verstaatlichung dieser
Chausseebau-Gesellschaft bildete die noch im Jahr 1856 bis nach Beeskow
weitergebaute Strecke einen Teil der preußischen Staatschaussee Nr. 33,
die bis nach Leipzig führte. Heute der östliche Abschnitt der B 87."
Zum
optischen Vergleich wird links eine Aktie derselben Serie gezeigt, die
auf der Auktions-Website "F.H.W. Freunde Historischer Wertpapiere"
(www.fhw-online.de) angeboten wurde; eine interessante Adresse für
Sammler und Liebhaber historischer Aktien und Wertpapiere. Dort heißt es
im Begleittext:
"... Von der zu überbrückenden Entfernung her war dies
das größte private Straßenbauprojekt aller Zeiten in Deutschland. ...
Die 1854 begonnene Kunststraße von Frankfurt a.d.O. nach Leipzig wurde
1856 bis Müllrose gebaut. Nach der Verstaatlichung dieser
Chausseebau-Gesellschaft bildete die noch im Jahr 1856 bis nach Beeskow
weitergebaute Strecke einen Teil der preußischen Staatschaussee Nr. 33,
die bis nach Leipzig führte. Heute der östliche Abschnitt der B 87."
Akten zu dieser Chausseebau-Gesellschaft gibt es beim Brandenburgischen
Landeshauptarchiv (BLHA) unter "Rep. 75 Frankfurt (Oder) - Leipziger
Chausseebau AG, Lübben". Zur Firmengeschichte wird mitgeteilt:
"Die Frankfurt (Oder) – Leipziger Chaussee Baugesellschaft
Aktiengesellschaft wurde mit Statut vom 19. April 1854 durch Allerhöchsten
Erlaß vom 20. November 1854 mit Sitz in Lübben gegründet und war für den
Bau und Unterhaltung der Chaussee von Frankfurt (Oder) bis nach Leipzig
zuständig. Aufgrund des Aufschwungs der Eisenbahn verringerte sich der
Verkehr auf der Straße und damit der Unterhaltungsaufwand für die Firma.
Hinzu kam die Nichtgewährung eines Unterhaltungszuschusses aus dem
öffentlichen Fonds. So beschloss die Gesellschaft am 29. Mai 1876 sich
zum 1.7.1876 aufzulösen. Die Unterhaltung der Straßen in der Provinz
Brandenburg ging an die Kreise Frankfurt (Oder), Lebus, Kreis
Beeskow-Storkow, Lübben und Luckau über."
Chausseebau ab 1869: Die Planungen zum erstmaligen
Bau einer Straße zwischen Kuschkow und Neu Lübbenau begannen 1869. Im BLHA gibt
es dazu aus dem Zeitraum 1869-1873 für Kuschkow die Akte "3B I V 2803"
mit der Bezeichnung "Chausseebau von Birkenhainchen über Kuschkow nach Buchholz
und zum Bahnhof Halbe, Kr. Beeskow". In der Ortschronik berichtet Familie
Scheibe auf Seite 21, dass am 30.1.1876 im Gemeinderat eine "Besprechung
des Kuschkower Beitrages zum Chausseebau nach Berlin" stattfand. Die Straße
war eine überörtliche Kreisstraße, die Gemeinde sollte sich aber wohl an der
Finanzierung beteiligen oder bei der Bauausführung mitwirken. Für Neu Lübbenau
existiert eine Karte bzw. Planzeichnung ebenfalls aus dem Jahr 1869 unter der Signatur
"55 Provinzialverband III K 1475 G" mit der Bezeichnung "Situations-
und Nivellementsplan für die projektierte Chaussee von Wendisch Buchholz über
Birkholz, Leibsch, Kolonie Neu Lübbenau bis zur Grenze der Kreise Beeskow-Storkow
und Lübben (R 179)". Die Pretschener Spree war hier die Kreisgrenze. Die
Holzbrücke über die Spree in Leibsch als Teil der neuen Chaussee und Ersatz für
die bis dato genutzte Furt wurde 1879 in Betrieb genommen; im Buch von Axel Pinkow
(siehe unten) ist sie auf den Seiten 15 und 16 abgebildet. Der Straßenbau bis
Kuschkow war offenbar in den frühen 1880er Jahren abgeschlossen, ein genaues
Datum konnte bisher nicht ermittelt werden. Das Ergebnis brachte erhebliche
wirtschaftliche Vorteile für die Gemeinde.
.jpg)
Chaussee zwischen Neu Lübbenau und Kuschkow im Zustand
um 1890. Karte des Deutschen Reiches, Blatt 319
Beeskow, aufgenommen vom Königlich Preussischen Generalstab 1844-46,
Maßstab 1:100.000, herausgegeben 1893 durch das
Reichsamt für Landesaufnahme. R. Eisenschmidt, Verlags-Buchhandlung,
Haupt-Vertrieb der Karten der Königl. Landes-Aufnahme, Berlin N.W.7,
Armee- und Marine-Haus. Bildquelle: © David Rumsey Map Collection,
Cartography Associates, Stanford University Libraries
(www.davidrumsey.com)
Diese topographische Karte ist eine der ersten amtlichen Darstellungen
mit der neuen Chaussee. Der hier gezeigte Bildausschnitt auf Basis der
Landesaufnahme von 1846 wurde offenbar bis 1893 (mehrfach ?) ergänzt,
jedenfalls ist die neue Chaussee bereits als Bestand eingetragen; wann
genau dieser Zustand erreicht war, geht aus der Karte nicht hervor. Da
der genaue Trassenverlauf im Grenzbereich zwischen Neu Lübbenau und Kuschkow
nicht der tatsächlich gebauten Chaussee entspricht (die Doppelkurve
fehlt), besteht der Verdacht, dass die Karte noch im Planungszustand vor
Fertigstellung des Straßenbaus gezeichnet wurde; zum Vergleich siehe die
Karten von 1901 weiter unten. Das um 1750 gegründete Neu Lübbenau wurde
noch als "Colonie Neu Lübbenau" bezeichnet. Einen größeren
Kartenausschnitt sehen Sie hier:
►,
das gesamte Blatt verkleinert hier:
►. Das gesamte Blatt in sehr hoher Auflösung und hervorragender Qualität
zum freien Download (mit Nutzungsbedingungen) gibt es bei David Rumsey, siehe direkt hier:
► ‒ eine außerordentlich interessante Website mit aktuell
mehr als 142.000 historischen Karten, Grafiken, Büchern und Fotos (Stand 2025).
.jpg)
Ortslage Kuschkow um 1901. Bildquelle: Karte des Deutschen Reiches / Topographische
Karte 1:25000, Messtischblatt 3949 Schlepzig, Königlich Preußische Landes-Aufnahme 1901, herausgegeben
1903, Auflagendruck 1918. © Arcanum Maps Budapest
(https://maps.arcanum.com/de); siehe dieses Blatt auch beim Leibnitz-Institut für Länderkunde
(https://ifl.wissensbank.com) oder beim BrandenburgViewer (https://bb-viewer.geobasis-bb.de). Einen
größeren Kartenausschnitt sehen Sie hier:
►
Die Karte ist exakt genordet, auch die Mühle südöstlich außerhalb des Dorfes ist eingetragen,
bezeichnet mit "zu Kuschkow". Die Ortsdurchfahrt in ihrer heutigen Form (B 179)
existiert jedoch noch nicht, die Gröditscher Straße als Verbindungsstück zwischen Ortsmitte
und dem südlichen Ende der Alten Straße (ehemals Koinzstraße) in Richtung Gröditsch ist noch
nicht vorhanden, dieser kurze Straßenabschnitt wurde erst um 1939 gebaut. Zur Projektierung
der Trasse und geplanten Regulierung der Flurstücke durch das Katasteramt liegen Unterlagen mit
ersten Entwürfen von 1937 im BLHA vor, der Bau wurde also erst danach begonnen. Zum Beispiel
musste auf dem damaligen Grundstück der Margarete Rattei, Pretschener Straße 58 (heute
Dorfgemeinschaftshaus), die rückwärtige Scheune samt Stall und Schuppen abgebrochen werden.
Die Chaussee vom Ende der Koinzstraße bis nach Gröditsch war bereits um 1924 entstanden bzw.
auf der alten Trasse neu ausgebaut; weitere Angaben dazu siehe auf der Startseite.
Zur ehemaligen Reichsstraße Nr. 179 (R 179) gibt es im BLHA ein
Bestandsbuch für den Zeitraum 1940-1944 unter der Signatur "55 Provinzialverband
III 2606". Die Straße wurde um 1937 von der Kategorie "Landstraße" zur
"Reichsstraße" erhoben, Grundlage war das Reichsgesetz zur Neuregelung des
Straßenwesens von 1934; während der DDR-Zeit Fernverkehrsstraße (F 179), seit 1990
Bundesstraße (B 179). Wie die Straßensituation 1940 aussah, zeigt das folgende Bild:
.jpg)
Ortslage Kuschkow um 1940. Bildquelle: Karte des Deutschen Reiches / Topographische
Karte 1:25000, Messtischblatt 3949 Schlepzig, Preußische Landesaufnahme 1901, herausgegeben 1903, letzte
Nachträge 1940, Ausgabe 1942. © Leibnitz-Institut
für Länderkunde (https://ifl.wissensbank.com). Wie die Karte zeigt, war die Ortsdurchfahrt 1940 fertiggestellt,
die Reichsstraße jetzt mit "179" bezeichnet und die Südseite der Pretschener Straße vollständig
bebaut. Das Symbol für die 1938 abgebrochene Windmühle ist nicht mehr vorhanden.
.jpg)
Ortslage Kuschkow um 1975. Bildquelle: Topographische Karte 1:25000 (Ausgabe für
die Volkswirtschaft), 0909-44 (Schlepzig), hergestellt durch VEB Kombinat Geodäsie und Kartographie,
herausgegeben durch Ministerium des Innern der DDR, Verwaltung Vermessungs- und Kartenwesen,
Ausgabe 1978, Stand der Unterlagen: 1975. ©
Leibnitz-Institut für Länderkunde (https://ifl.wissensbank.com). Die DDR-Karte im gleichen Maßstab
wie das Messtischblatt des Deutschen Reiches oben zeigt kaum noch interessante Details für den
Heimatforscher. Erst im nächstgrößeren Maßstab sind wieder Details erkennbar:
.jpg)
Ortslage Kuschkow um 1980. Bildquelle: Topographische Karte 1:10000 (Ausgabe
für die Volkswirtschaft), Blatt 0909-442 (Kuschkow), hergestellt durch VEB Kombinat Geodäsie
und Kartographie, herausgegeben durch Ministerium des Innern der DDR, Verwaltung Vermessungs-
und Kartenwesen, Ausgabe 1978, Stand der Unterlagen: 1981; Kartenblatt im
eigenen Bestand.
.jpg)
Luftbild von Kuschkow 2001 zum Vergleich mit dem Kartenbild von 1980 oben; es hat kaum
bauliche Entwicklungen gegeben in diesem Zeitraum. Bildquelle: Großformatiges Originalfoto (auf Fotopapier)
im Maßstab ca. 1:2000, © Landesvermessung und Geobasisinformation
Brandenburg, Film-Nr.: 26-01, Bild-Nr.: 260, Aufnahme-Datum: 1.5.2001, Senkrechtaufnahme (Orthofoto),
Gebietsbezeichnung: Kuschkow. Wenn Sie dieses Luftbild in höherer Auflösung sehen wollen, dann klicken Sie
hier: ►
.jpg)
Kuschkow in seiner Umgebung um 1901, Übersicht über die landschaftliche
Situation als Ergänzung zur oben gezeigten Ortslage aus der gleichen Zeit. Sehr gut
sind hier die vielen Feuchtgebiete, Fließe und Gräben im Umfeld des Dorfes zu sehen, das
große Luchgebiet zwischen Kuschkow und Krugau wird durch den "Land-Graben"
entwässert. Bitte klicken Sie hier:
►,
dann sehen Sie eine Vergrößerung der Karte. Bildquelle: Karte des Deutschen Reiches M 1:100000,
Blatt 319 Beeskow. Aufgenommen von der Topographischen Abteilung der Königlich Preußischen
Landesaufnahme 1901, herausgegeben 1908. Digitalisiert in hoher Auflösung von der Deutschen
Fotothek Dresden unter https://www.deutschefotothek.de/gallery/freitext/df_dk_0000532_0319
‒ die Übersichtskarte zur Auswahl für das Deutsche Reich finden Sie hier:
https://www.deutschefotothek.de/documents/obj/90011269. Sogar in diesem Maßstab ist die
Mühle südöstlich von Kuschkow am Weg nach Krugau eingetragen.
.jpg)
Kuschkow in seiner Umgebung um 1901, Übersicht über die
Einbindung in das Straßen- und Wegenetz als Ergänzung zur
oben gezeigten Ortslage aus der gleichen Zeit, zur Vergrößerung wieder hier
klicken:
►.
(Bildquelle: Karte des Deutschen Reiches M 1:100000, topographische
Landesaufnahme 1901 (?); © Museum
Schloss Lübben, Museumsarchiv, mit freundlicher Genehmigung fotografiert
von Doris Rauscher am 18.11.2024).
Erstmalig konnte auf den Karten ab 1901 auch die Bahnstrecke Falkenberg
‒ Lübben ‒ Beeskow vollständig als Bestand dargestellt werden
mit den von Kuschkow aus nächstgelegenen Bahnhöfen Groß Leuthen und Krugau.
Der Streckenabschnitt zwischen Lübben und Beeskow wurde Ende 1901 in Betrieb
genommen, der erste Abschnitt zwischen Falkenberg und Lübben bereits 1898.
Karte des Markgraftums Niederlausitz von
Peter Schenk 1757
Im Folgenden soll eine inhaltlich ganz besonders interessante und aus grafischer Sicht auch
besonders schöne topographische Karte vorgestellt werden, äußerst sorgfältig ausgearbeitet
auf 4 Teilblättern, mit Planzeichenerklärung und als Original in guter Qualität erhalten.
Dargestellt ist auch das Dorff Kuschke mit einer Kirche. Kartograph war
Peter Schenk d. J. (1693-1775), Sohn des Peter Schenk d. Ä. (1660-1711, auch
Pieter / Petrus Schenck, Mitinhaber des berühmten Kartenverlagshauses Valck und Schenck in
Amsterdam, weitere Informationen dazu im Literaturverzeichnis bei Wiegand):
Geographische Delineation, des zu denen Kur Sächsischen Landen
gehörigen Marggraffthums Nieder Lausitz, Worinnen enthalten die Fünff Kreisse
als I. der Luckauische, II. Gubenische, III. Kalauische,
IV. Krumspreeische oder Lübbenische, und V. der Sprembergische
Kreiß, nebst denen darinnen befindlichen Herrschafften und Aemtern, als 1. Neüenzella in II.
Kreiße, 2. Dobrelugck, I. 3. Friedland, IV. 4. Forst, II.5. Pförten, II. 6. Sorau und Triebel, II. 7
Leitten, IV. 8. Sonnewalda, I. 9. Drehna, I. 10. Straupitz, IV. 11. Lieberosa, IV. 12. Lübbenau III.
und 13. Amptitz, II. wie auch ihren Städten, Rittergüthern und Dorffschafften Samt den Kur
Brandenburgischen Antheile dieses Marggraffthumbs, auch andern angrentzenden Gegenden. in Amsterdam
bey Petrus Schenk, mit Königl. Pohl. und Kurfürstl. Sachßl. Privilegio,
1757.
Bildquelle: Fotos der vier historischen Originalkarten, ©
Brandenburgisches Landeshauptarchiv (BLHA), Signatur: AKS 1320 A am 16.11.2021 und AKS 1319 B
am 23.11.2021; Fotografin: Doris Rauscher, digitale Bildbearbeitung (Optimierung): Norbert Rauscher,
jeweils das vollständige Kartenblatt und Ausschnitte. Die Karten sind genordet und werden hier in
folgender Reihenfolge gezeigt: Blatt 1 = Nordwest (oben links, mit Schriftfeld),
Blatt 2 = Nordost (oben rechts, mit Nordstern und Planzeichenerklärung),
Blatt 3 = Südwest (unten links) und Blatt 4 = Südost (unten
rechts, mit grafischer Maßstabsleiste). Maßstab ist die "Teutzsche Meile deren 15 einen Grad
machen", es wird jedoch kein Maßstabsverhältnis (Verhältniszahl zum Blattmaß der Karte)
angegeben. Die Gemeine Deutsche Meile 15 auf 1 Grad = Geographische Meile hatte 7420,44 Meter.
Das Kartenwerk wird auch behandelt bei Bütow / Schwuchow auf den Seiten 32-35, siehe
Literaturverzeichnis.
(► Hinweis: Unter der Maßstabsleiste wurde später mit
Bleistift eine Maßstabsberechnung aufgetragen: 1 Preußische Landmeile = 2000 Ruten = 7,532 Km,
woraus sich der nachträglich errechnete Kartenmaßstab = ca. 1:125.000 ergibt. Diese Berechnung
ist falsch, weil hier irrtümlich die Preußische Landmeile angesetzt wurde und nicht die
Deutsche Geographische Meile.)
Zuerst Blatt 1 mit Schriftfeld und dem Dorf Kuschkow (Kuschke). Delineation =
Zeichnung, Darstellung, Skizze. Alle Städte, Dörfer und sonstigen Örtlichkeiten wie Schlösser,
Klöster, Kirchen, Mühlen usw. bis hin zu Pferdewechselstationen an Poststraßen sind plangrafisch sehr
genau durch Symbole bzw. Symbolkombinationen dargestellt, siehe dazu unten die Planzeichenerklärung.
Die Kuschkower Kirche ist nach dieser Planzeichenerklärung eine "Kirche, welche allzeit
mit einer geraden Linea an ihrer Haupt Kirche henget." Eine vergleichbare, aber nicht
identische Symbolik wurde auch unter Zürner bis 1742 bei den oben gezeigten Karten verwendet,
jeder Kartograph und seine Mitarbeiter hatten einen eigenen Symbolkatalog in Gebrauch. Blatt
1 in hoher Auflösung sehen Sie hier:
►
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Es folgt Blatt 2 mit Nordstern und Planzeichenerklärung, diese danach als vergrößerter Auszug.
Das gesamte Blatt 2 in hoher Auflösung finden Sie wieder hier:
►.
Die folgenden Planzeichen kommen in Verbindung mit dem Dorf Kuschkow zur Anwendung:
• Ein Dorff mit einer Filial Kirche, welche allzeit mit einer geraden Linea an ihrer
Haupt Kirche henget. • Ammtssässig. • Eine kleine Schenke. •
Ein Försterhaus. • Ein Schmidt. • Eine Herren Schäferey. Die Filialkirche
in Kuschkow (Kuschke, ohne Kreuz auf dem Turm) ist gebunden an ihre Hauptkirche in Krugau (Kruge,
mit Kreuz auf dem Turm = Pfarrkirche, Pastorat). Das Dorf Gröditsch (Kregisch) hat gar keine
Kirche und ist eingepfarrt nach Krugau, ebenso Biebersdorf. Der Nordstern oben links auf der Karte
zeigt die Nordrichtung durch ein Liliensymbol an und die Ostrichtung durch ein Kreuzsymbol,
ähnlich dem Kreuz auf der Pfarrkirche (Osten = Himmelsrichtung des Altars). Mit
"Ein Schmidt" ist sicher der Gemeindeschmied Johann Jazosch
gemeint, Vorfahre meiner väterlichen Familie; weitere Angaben dazu gibt es auf der Sonderseite
zur Schmiede der Familie Jäzosch.
.jpg)
.jpg)
Zuletzt folgen die Blätter 3 und 4 des kartographischen Gesamtwerkes.
Blatt 3 in hoher Auflösung sehen Sie hier:
►, Blatt 4 sehen Sie hier:
►. Besonders auf diesem Blatt erscheint auch der große
und heute zu Polen gehörende Anteil der Niederlausitz östlich der Neiße.
Unterhalb der grafischen Maßstabsleiste wurde nachträglich mit Bleistift
eine Umrechnung in preußische Landmeilen und Kilometer aufgetragen,
woraus sich ein Maßstab für das Kartenwerk von etwa 1:125000 ergibt.
.jpg)
.jpg)
Reisekarte für das Kurfürstentum Sachsen nach
Johann Baptist Homann 1728 / 1752
Es folgt eine weitere sehr interessante Karte mit grafisch fein ausgearbeitetem
Beiwerk, auf der das Dorf Kuschkow leider nicht verzeichnet ist, der man
aber sehr gut entnehmen kann, wie das damalige Amt Lübben mit seinen
Dörfern im Krummspreekreis ("Crumspreeischer Kreis") in das
überregionale System der Heerstraßen / Handelsstraßen / Poststraßen um 1728
eingebunden war. Die Karte wurde offenbar noch unter Johann Baptist Homann
(1664-1724, Kartograph, Kupferstecher, Verleger) ausgearbeitet, jedoch erst
1752 von den Erben Homanns herausgegeben. Bildquelle: Fotos der historischen
Originalkarte, © Museum Schloss Lübben,
Museumsarchiv, Inventar-Nummer: VII/891, mit freundlicher Genehmigung
abfotografiert von Doris Rauscher am 18.11.2024, digitale Bildbearbeitung
(Optimierung) durch Norbert Rauscher. Die Reisekarte wird behandelt bei
Bütow / Schwuchow auf den Seiten 44-45, siehe Literaturverzeichnis.
Die Karte ist überschrieben mit: "Carte itineraire par
le Pays de l'Electorat de Saxe faisant voir les
grands chemins depuis Lipsic jus qu' aux
Villes les plus principales des Pays Circonvoisins, faite en faveur du
Commerce & publiée par les soins des Heritiers de Homann l'An 1752"
(Reisekarte durch das Kurfürstentum Sachsen mit den Hauptstraßen von
Leipzig zu den wichtigsten Städten der umliegenden Länder, erstellt zur
Förderung des Handels und veröffentlicht von den Erben Homanns im Jahr 1752).
Unterhalb dieser Überschrift werden die "Weiten von Leipzig aus
in die vornehmsten Handelsstädte in Reise Stunden genommen". Einige
Merkwürdigkeiten fallen dabei auf: So ist z.B. die Reisezeit von
Leipzig bis nach Frankfurt an der Oder mit 88 Stunden angegeben, nach
dem deutlich weiter entfernten Stettin jedoch nur mit 76 Stunden. Zu
beachten ist dabei, dass die Angaben nicht auf Messungen beruhen sondern
auf den Berichten von Reisenden, die naturgemäß sehr unterschiedlich
ausgefallen sind. Eine Postkutsche erzielte kürzere Fahrzeiten als ein
mit Waren beladenes Fuhrwerk der Kaufleute. Rechts neben der Tabelle
heißt es: "... das Publicum wird ersucht, uns die nöthige Nachrichten
mitzuteilen ..."; die Kartographen waren also auf die Informationen
der Reisenden angewiesen und verwendeten dann bei mehreren Angaben zum
selben Ziel vermutlich die Durchschnittswerte.
In der Kartusche oben rechts steht: "Hohe Heer-Strasse durch das Chur
Fürst Sachsen. Wie selbige aus Polen u. Schlesien in die Lande
Thüringen, Sachsen, Meissen, u. so ferner gehen soll, ingl. wie Sie auf
unterschiedl. Art zu Wasser und Land umfahren wird, entworfen von G. C.
K. Reichenb. Variseo 1728." Unten rechts gibt es eine Maßstabsleiste mit der
Bezeichnung "Gemeine teutsche Meilen 15 auf einen Grad gerechnet.",
jedoch ohne Maßstabsverhältnis / Verhältniszahl zum Blattmaß der Karte. Die
Gemeine deutsche Meile 15 auf 1 Grad = Geographische Meile hatte 7420,44 Meter.
Zuerst sehen Sie die Gesamtansicht der Karte (Vergrößerung hier:
►).
Danach ein Ausschnitt oben rechts mit der Textkartusche (Vergrößerung siehe hier:
►)
und ein zweiter Ausschnitt mit dem Krummspreekreis mit Lübben und Lübbenau
sowie den Dörfern Leibchel und Biebersdorf im weiteren Umfeld. Alle Details
der Darstellung scheinen jedoch nicht den Tatsachen zu entsprechen: Nach der
Karte von Peter Schenk 1757 (siehe oben) gab es z.B. zwischen Müllrose und
Frankfurt eine Straßenverbindung, die mit Sicherheit auch als Post- und
Handelsstraße genutzt wurde; diese Straße fehlt bei Homann.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Links ist der grafisch gestaltete obere linke Teil der Karte mit den
Anmerkungen zum Straßensystem zu sehen (Bildvergrößerung
siehe wieder hier:
►).
Alle Handelsstraßen ("hohe Heer-Strassen") sind in der Karte
mit Buchstaben markiert (A, B, C, ..., L, M). In den Anmerkungen werden für
jede dieser Straßen das Gründungsdatum sowie die mit jedem Herrschaftswechsel
erneuerten kaiserlichen bzw. königlichen Privilegien, Rechte und Pflichten
usw. vollständig aufgezählt, dazu Anzahl und Lage der Brücken, Schleusen,
Zollstationen usw. und wie mit ihnen zu verfahren ist. Teilweise wird auch
auf ein gewisses Gefahrenpotenzial der Straßen hingewiesen.
Der nächste Ausschnitt zeigt die Grafik unten rechts mit zwei Handelsfuhrwerken
auf ihrem mühsamen und von Postsäulen markierten Weg. Der Straßenzustand, den
diese Fuhrwerke teilweise zu bewältigen hatten, ist andeutungsweise dargestellt.
Darunter befindet sich eine Maßstabsleiste über 10 deutsche Meilen, jedoch ohne
Maßstabsverhältnis / Verhältniszahl zum Blattmaß der Karte (Vergrößerung
siehe hier:
►).
.jpg)
Am unteren Blattrand wird über das seit 1494 / 1507 bestehende und durch den
Kaiser verliehene Markt- und Stapelrecht der Stadt Leipzig
berichtet mit einem Umkreis von 15 Meilen und den damit verbundenen dreitägigen
Stapelzwang für alle reisenden Handelsleute und Handwerker in diesem Bereich
(Blattvergrößerung siehe hier:
►).
Betroffen waren auch die Schiffe auf Elbe und Saale. Erst wenn sich in
dieser Zeit keine Käufer fanden, durften die Händler "nach Abstattung
der Niederlags Gebühr" ihre Waren aufladen und abtransportieren. Die
15-Meilen-Stapelzone um die Stadt ist in der Karte durch gestrichelte
Linie eingetragen; kein anderer Ort in diesem Bereich war befugt, sich
ein gleiches Niederlagerecht anzumaßen. Den fahrenden Händlern war es
verboten, die "ordentlichen und privilegierten" Handelsstraßen zu
verlassen und auf Schleichwegen ("Bey- und Schleifwege") die Stadt
Leipzig zu umfahren, bei Androhung von "Verlust Pferde Wagen und Ladung".
Sogar die kleinen Städte Lübben und Lübbenau in der Niederlausitz lagen noch
innerhalb dieser Stapelzone (!), aber auch z.B. Dresden und Erfurt. Weitere Hintergründe
zu diesen handelsrechtlichen Regelungen können hier nicht geklärt werden.
.jpg)
Interessante Mitteilungen zur Entwicklungsgeschichte des überregionalen
sächsischen Straßensystems findet man z.B. bei Rainer Aurig (siehe
Literaturverzeichnis unten). Die Landstraße von Leipzig über Torgau,
Herzberg, Luckau, Lübben, Beeskow und Müllrose nach Frankfurt an der
Oder gehörte zu den ältesten deutschen Heer- und Poststraßen, bereits in
der Landstraßenkarte von Erhard Erzlaub aus Nürnberg von 1501 ist sie
enthalten, damals auch als "Hohe Straße" oder "Frankfurter Geleis"
bezeichnet. Nach den (unvollständigen) kartographischen Darstellungen
aus der Zeit um 1750 hatte Kuschkow Anbindungen an diese überregionale
Landstraße entweder südliche über Dürrenhofe ‒ Lübben oder östlich
über Gröditsch ‒ Krugau ‒ Biebersdorf oder nördlich über
Pretschen ‒ Wittmannsdorf ‒ Schuhlen.
Der Ausbau zur Chaussee erfolgte ab 1854, dazu wurde eine
Aktiengesellschaft gegründet, die "Frankfurt an der Oder - Leipziger
Chausseebau - Aktiengesellschaft" mit Sitz in Lübben; das Statut
dieser Gesellschaft wurde 1854 durch den König von Preußen bestätigt,
von da an wurden Aktien ausgegeben (siehe Abbildungen und Text oben). Akten
dazu gibt es beim Brandenburgischen Landeshauptarchiv (BLHA) unter
"Rep. 75 Frankfurt (Oder) - Leipziger Chausseebau AG, Lübben".
Später wurde daraus die Preußische Staatschaussee Nr. 33, dann die
Reichsstraße 87 (R 87), während der DDR-Zeit die Fernverkehrsstraße 87
(F 87) und nach 1990 die Bundesstraße 87 (B 87).
Quellen- und Literaturverzeichnis
Hinweis: Hier finden Sie nur Literaturangaben zum Spezialthema dieser Seite. Das allgemeine Literaturverzeichnis
zu Kuschkow und der Niederlausitz als Thema der gesamten Website finden Sie auf der Hauptseite (Startseite,
siehe hier: ►).
Amtliches Gemeindeverzeichnis für das Deutsche Reich auf Grund der Volkszählung 1939.
Herausgegeben vom Statistischen Reichsamt. Zweite Auflage. Verlag für Sozialpolitik, Wirtschaft und
Statistik, Paul Schmidt, Berlin 1941. Kuschkow auf Seite 65: Ständige Bevölkerung (St.B.) = 506,
Wohnbevölkerung insgesamt = 697
Aurig, Rainer: Möglichkeiten und Grenzen interdisziplinärer Altstraßenforschung vorwiegend
mit Beispielen aus der westlichen Niederlausitz. Enthalten in: Im Schatten mächtiger
Nachbarn. Politik, Wirtschaft und Kultur der Niederlausitz zwischen Böhmen, Sachsen und
Brandenburg-Preußen. Herausgegeben von Klaus Neitmann. BeBra Wissenschaft Verlag, Berlin 2006;
Seiten 111 bis 139 (als Open Access zum kostenlosen Download unter www.bebra-wissenschaft.de)
Beiträge zur deutschen Kartographie. Den Mitgliedern des 20. Deutschen Geographentages
... gewidmet von der Deutschen Bücherei. Herausgegeben von Dr. Hans Praesent. Akademische
Verlagsgesellschaft m.b.H., Leipzig 1921. Digitalisiert von Internet Archive unter
https://archive.org/details/beitrgezurdeut00prae ‒ Darin enthalten:
- Beschorner, Hans: Landesvermessung und Kartenwesen Kursachsens bis 1780. (Seiten 32-46)
- Treitschke, Curt: Die Landesaufnahme Sachsen von 1780 bis 1921. (Seiten 47-60)
Boer, Wierd Mathijs de: Entstehung und Geomorphologie des Unterspreewaldes (Literaturauswertung).
Erschienen in: Biologische Studien, Heft 26, Luckau 1997; Seiten 3-10 (siehe direkt hier:
►). Der Beitrag
bietet einen Überblick über diverse Fachpublikationen, die sich mit der naturräumlichen Abgrenzung der Region
Unterspreewald (Niederspreewald) befassen.
Brandenburg um 1900 auf topographischen Karten des Deutschen Reiches / Messtischblätter M 1:25000,
im Internet zu finden bei © Arcanum Maps Budapest (https://maps.arcanum.com/de), siehe direkt hier:
► ‒ hervorragend zum nahtlosen Navigieren durch die ganze Provinz Brandenburg
Brandenburgisches Landeshauptarchiv ‒ BLHA, im Internet unter https://blha.brandenburg.de
(siehe direkt hier: ►) mit
Rechercheangeboten zu sämtlichen historischen Dokumenten der brandenburgischen Landesgeschichte. Viele
der Dokumente sind inzwischen digitalisiert und per Internet frei zugängig, auch diverse Fachbücher kann
man sich als PDF-Dateien herunterladen.
Bütow, Sascha / Schwuchow, Benjamin: Die Nieder- und Oberlausitz im Bild historischer Karten.
Studien zur brandenburgischen und vergleichenden Landesgeschichte, Band 15. Herausgegeben von Heinz-Dieter
Heimann und Klaus Neitmann. Lukas Verlag, Berlin 2014. Zum kostenlosen Download beim BLHA unter https://blha.brandenburg.de
Chronik der Gemeinde Kuschkow. Herausgegeben von der Gemeindevertretung Kuschkow zur
675-Jahrfeier 2003; Redaktion und inhaltliche Bearbeitung durch Familie Gerhard Scheibe; Kuschkow 2003
Das Reichsamt für Landesaufnahme und seine Kartenwerke. Verlag des Reichsamts für
Landesaufnahme, Berlin 1931. Als PDF im Internet z.B. unter
https://www.luftfahrt-bibliothek.de/buch-reichsamt-landesaufnahme-kartenwerke.htm ‒ betrifft
fachliche Hinweise zu den oben gezeigten topographischen Karten (Messtischblätter).
Eisenschmidt, Ralph: Systematische Ungenauigkeiten des Aufnahmeverfahrens im preußischen Steuerkataster
von 1865. Enthalten in: FORUM. Zeitschrift des Bundes der Öffentlich bestellten Vermessungsingenieure
e.V. (BDVI), Berlin, Heft 2/2021; Seiten 30-45
Gebbert, Thomas / Hartmann, Dietwalt / Reichert, Frank: Aufnahme und Darstellung der Ortslagen in den
Separations- und Katasterkarten der östlichen Provinzen Preußens. Enthalten in: FORUM. Zeitschrift des
Bundes der Öffentlich bestellten Vermessungsingenieure e.V. (BDVI), Berlin, Heft 3/2018; Seiten 28-39
Gentzen, Udo: Verborgene Orte. Spurensuche auf Separationskarten. Enthalten in: Vermessung
Brandenburg, Heft 1/2020, herausgegeben vom Ministerium des Innern und für Kommunales des Landes Brandenburg
(MIK), Potsdam 2020; Seiten 4-35. Als PDF zu finden auf der LGB-Website unter
https://geobasis-bb.de/sixcms/media.php/9/vbb_120.pdf (Stand: 21.7.2022)
Henker, Jens & Kirsch, Kerstin: Dorfgründungen in der Lausitz. Horno und Klein
Görigk im Focus. Enthalten in: Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft für Archäologie
des Mittelalters und der Neuzeit (DGAMN), Band 27 (2014), Paderborn 2014; Seiten 171-180
(als PDF im Internet zu finden, siehe direkt hier:
►)
Hoffmann, Helmut: 150 Jahre Liegenschaftskataster in der Region Berlin/Brandenburg ‒ Aufbau
des Liegenschaftskatasters aus dem 'Nichts': ‒ wie war das 1861? Enthalten in: Vermessung
Brandenburg, Heft 2/2011, herausgegeben vom Ministerium des Innern des Landes Brandenburg, Potsdam 2011;
Seiten 18-26
Leonhardi, Friedrich Gottlob: Erdbeschreibung der Churfürstlich- und
Herzoglich-Sächsischen Lande. Vierter Band. Dritte vermehrte und verbesserte
Auflage. Leipzig 1806 bei Johann Ambr. Barth. Seiten 345-476: Die Markgrafschaft
Nieder-Lausitz ... (vollständige Beschreibung des Gebietes, welches mit dem
Wiener Kongress 1815 an Preußen kam); Seite 449: "Der Lübbener oder Crumspreeische
Kreis"; Seite 452: "Kuschkau und Krugau insgesammt mit Kirchen" (Kuschkau
war zeitweise die eingedeutschte Namensvariante von Kuschkow)
Meyer, Hans-Heinrich: Historische topographische Karten als Hilfsmittel der
Kulturlandschafts- und Flurnamenforschung. Enthalten in: Namen und Kulturlandschaften.
Hrsg. von Barbara Aehnlich und Eckhard Meineke. Leipziger Untersuchungen zur Namenforschung, Band 10;
Leipziger Universitätsverlag GmbH 2015; Seiten 259-286. Als PDF zu finden auf der Website der
Universität Leipzig unter www.philol.uni-leipzig.de (siehe direkt hier:
►).
Auch wenn das Thema am Beispiel Thüringen abgehandelt wird, so ist doch die Gesamtdarstellung der
kartographischen Entwicklungsgeschichte auch für Brandenburg interessant.
Pinkow, Axel: Der Spreewald. Historische Ansichtskarten in Wort und Bild. Band 1.
Herausgegeben im Selbstverlag, Königs Wusterhausen 2002
Schneitler, Carl Friedrich: Lehrbuch der gesammten Meßkunst oder Darstellung der Theorie und Praxis des
Feldmessens, Nivellirens und des Höhenmessens, der militairischen Aufnahmen, des Markscheidens und der Aufnahme ganzer
Länder, sowie der geometrischen Zeichenkunst. Zum Selbststudium und Unterricht ... Zweite verbesserte Auflage. Mit 179 in
den Text eingedruckten Figuren in Holzschnitt. Druck und Verlag von B. G. Teubner, Leipzig 1854. Digital vom Münchener
DigitalisierungsZentrum für die Bayerische Staatsbibliothek unter
https://www.digitale-sammlungen.de/de/view/bsb10083335?page=5
Stichling, Paul: Die preußischen Separationskarten 1817-1881, ihre grenzrechtliche und grenztechnische
Bedeutung. Sammlung Wichmann, Band 7. Verlag Herbert Wichmann, Berlin 1937 (digitalisiert von der Staatsbibliothek
zu Berlin, Preußischer Kulturbesitz, unter https://resolver.staatsbibliothek-berlin.de/SBB0000EEC900000000)
Wenzel, Walter: Niederlausitzer Ortsnamenbuch. Domowina-Verlag, Bautzen 2006
Wiegand, Peter: Peter II. Schenk (Kartograph). Enthalten in: Sächsische Biografie,
herausgegeben vom Institut für Sächsische Geschichte und Volkskunde, verfügbar unter
https://saebi.isgv.de/biografie/Peter_II._Schenk_(1693-1775) ‒ einen Ausdruck als PDF finden
Sie direkt hier:
►
Wolkenhauer, Wilhelm: Leitfaden zur Geschichte der Kartographie in tabellarischer
Darstellung. Mit Hinweis auf die Quellen-Litteratur unter besonderer Berücksichtigung Deutschlands,
Österreichs und der Schweiz. Ferdinand Hirt, Königliche Universitäts- und Verlags-Buchhandlung.
Breslau 1895. (digitalisiert von Google)
Zwahr, Johann Georg: Niederlausitz-wendisch-deutsches Handwörterbuch. Herausgegeben von J. C. F. Zwahr,
Druck von Carl Friedrich Säbisch, Spremberg 1847. Digitalisiert und als PDF zur Verfügung gestellt z.B. von Google (siehe
direkt hier: ►).
Seitenübersicht
► Startseite Kuschkow-Historie ‒ Das Dorf Kuschkow und seine Geschichte in Bildern und Texten
► Die Kuschkower Mühle ‒ Mühlengeschichte und die Müllerfamilien Wolff / Jäzosch
► Die Schmiede der Familie Jäzosch ‒ Geschichte einer Dorfschmiede mit ihren Familien ab 1435
► Jutta Jäzosch, geborene Thiele ‒ Familiengeschichte Thiele mit Flucht und Vertreibung
► Hochzeitsfeiern und Hochzeitsfotos ‒ Teil 1 ‒ Das Heiraten in Kuschkow und der Niederlausitz
► Hochzeitsfeiern und Hochzeitsfotos ‒ Teil 2 ‒ Das Heiraten in Kuschkow und der Niederlausitz
► Die Dorfschule in Kuschkow ‒ Dorflehrer und Schulkinder in Bildern und Texten
► Schulchronik der Gemeinde Kuschkow ‒ Teil 1.1 ‒ 1891 bis 1924 ‒ Seiten 0 bis 77
► Schulchronik der Gemeinde Kuschkow ‒ Teil 1.2 ‒ 1924 bis 1929 ‒ Seiten 78 bis 111
► Schulchronik der Gemeinde Kuschkow ‒ Teil 1.3 ‒ 1929 bis 1947 ‒ Seiten 112 bis 148, Beilagen
► Schulchronik der Gemeinde Kuschkow ‒ Teile 2 und 3 ‒ 1947 bis 1953
► Schulchronik der Gemeinde Kuschkow ‒ Teil 4 ‒ 1953 / 1960 bis 1968 ‒ Meine eigene Schulzeit
► Klassenbücher aus der Dorfschule in Kuschkow ‒ Jahrgänge 1950/1951 und 1954/1955
► Klassenbuch aus der Dorfschule in Kuschkow ‒ Jahrgang 1958/1959
► Die Lehrerin Luise Michelchen ‒ Ein 107-jähriges Leben in Berlin-Charlottenburg und Kuschkow
► Die Kuschkower Feuerwehr ‒ Dorfbrände, Feuerwehrgeschichte und Feuerwehrleute
► Historische topographische Karten ‒ Kuschkow und die Niederlausitz auf Landkarten ab 1687
► Separationskarten und Flurnamen ‒ Vermessung und Flurneuordnung in der Gemarkung ab 1842
► Der Friedhof in Kuschkow ‒ Friedhofsgeschichte, Grabstätten und Grabsteine
► Verschiedenes ‒ Teil 1.1 ‒ Bilddokumente aus Kuschkow und Umgebung ‒ Zeit vor 1945
► Verschiedenes ‒ Teil 1.2 ‒ Bilddokumente aus Kuschkow und Umgebung ‒ Zeit um 1940 bis 1960
► Verschiedenes ‒ Teil 2.1 ‒ Bilddokumente aus Kuschkow und Umgebung ‒ Zeit um 1950 bis 1965
► Verschiedenes ‒ Teil 2.2 ‒ Bilddokumente aus Kuschkow und Umgebung ‒ Zeit nach 1960
► Reiten und Reiter in Kuschkow ‒ Reitfeste, Reiterspiele und Brauchtum mit Pferden
► Historische Ortsansichten ‒ Teil 1 ‒ Fotos und Zeichnungen aus anderen Orten der Niederlausitz
►
Historische Ortsansichten ‒ Teil 2
‒ Fotos und Zeichnungen aus anderen Orten der Niederlausitz
Impressum und Datenschutz
Letzte Aktualisierung dieser Seite am 10.1.2026
Dies ist die private Website von Doris Rauscher, 16548 Glienicke/Nordbahn, Kieler Straße 16,
Telefon: 0173 9870488, E-Mail: doris.rauscher@web.de
Copyright © Doris Rauscher 2021-2026
Hinweis zur Beachtung: Diese Website und ihre Unterseiten sind optimiert
für Desktop-PC und Notebook bzw. Laptop, nicht jedoch für Tablet und Smartphone, dort kommt es leider zu Fehldarstellungen.